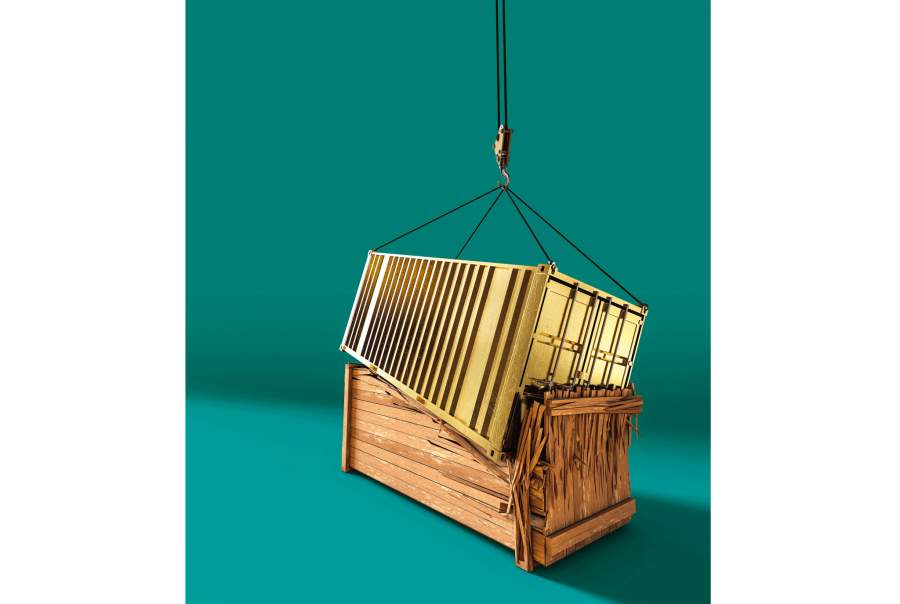
Warum Docker rockt
Mit Containern Zeit und Nerven sparen
Nicht nur für Admins und Webentwickler sind Docker-Container eine nützliche Sache. Jeder, der häufig Software ausprobiert, profitiert davon. Besonders gilt das für Webanwendungen, die oft mühselig aufzusetzen sind. Doch leider birgt Docker auch Gefahren. Wie so oft liegen Wohl und Wehe eng beieinander.
Erfunden worden ist Docker, um Webentwicklern und Administratoren das Leben zu erleichtern: Sie können Anwendungen zu Paketen schnüren, Docker-Images genannt, die sich bequem verteilen lassen. Diese Images liegen in einer Registry, etwa auf den Servern der Firma Docker Inc, aus der sie sich der lokal laufende Docker-Daemon herunterlädt. Mit einem Befehl startet der Docker-Daemon die im Image enthaltene Software als Prozess in einem sogenannten Container. Ein Container verwendet spezielle Technik im Betriebssystem, die Prozesse stärker voneinander trennt als bisher; so erhält ein Container zum Beispiel eine eigene Netzwerkkarte und sieht fremde Prozesse sowie Daten nicht. Ein Image ist für sich vollständig, enthält also alle zum Ausführen der Anwendung nötigen Bibliotheken.
Längst ist Docker aber kein reines Admin- und Entwicklerglück für Linux-Liebhaber mehr. Moderne NAS-Geräte spannen Docker-Images als Funktionserweiterungen ein. Auf dem Raspberry Pi erleichtern sie zunehmend die Installation komplexer Softwareprojekte. Selbst für moderne Windows-Versionen stellt Microsoft höchstselbst Docker bereit: Dort gibt es Container sowohl mit Windows- als auch mit Linux-Inhalt. So hat sich Docker mehr und mehr zu einer Alternative fürs Einrichten und Betreiben von Software gemausert und tritt zumindest auf Serversystemen in Konkurrenz zu Paketmanagern und Vollvirtualisierung.
Profiteure
Von der Vereinfachung profitieren im besonderen Maße Anwendungen, die als Frontend einen Webbrowser bemühen, aber nicht nur. Die Serverseite solcher Webanwendungen hat oft Abhängigkeiten: Sie setzt einen Webserver in bestimmter Konfiguration voraus, greift auf komplexe Frameworks zurück und verlangt moderne spezifische Versionen und besondere Erweiterungen derselben. Das wächst sich bei regulärer Installation schnell in einen Wartungsalbtraum aus. Ein Docker-Image kann das alles zusammenfassen und als reproduzierbare Installation handhabbar machen. Dank Containerisierung laufen mehrere solcher Anwendungen trotz unterschiedlicher Abhängigkeiten friedlich nebeneinander.
Einzelne Komponenten solcher Anwendungen, etwa eine benötigte Datenbank, steckt man üblicherweise nicht in dasselbe Image, sondern bemüht ein separates und lässt die Container dann übers Netzwerk miteinander reden. So können komplizierte Gebilde voneinander abhängiger Container entstehen, die zusammen eine Anwendung bilden. Das Einrichten ist trotzdem mit einer Befehlszeile getan, dank docker-compose. Es startet und verbindet mehrere Container und verarbeitet dazu eine YAML-Datei, in der die Abhängigkeiten untereinander beschrieben sind. Klingt alles prächtig und ist nicht schwer zu lernen [1].
Am Beispiel der Software für einen Magic Mirror [2] lassen sich die Vorzüge einer Installation via Docker schnell erkennen. Das übliche Einrichten des Projekts setzt allein wegen des Shell-Skript-Downloads entweder grenzenloses Vertrauen voraus oder viele einzelne Schritte, in denen unter anderem ein aktuelles Node.js installiert wird – all das hinterlässt im jeweiligen System unter Umständen Spuren abseits offizieller Installationsmechanismen, was erfahrene Admins aufgrund schlechter Wartbarkeit vermeiden. Mit Docker ist das Einrichten ein Einzeiler. Räumt man den Container nebst Image weg, sind alle Spuren getilgt.
Unter der Haube steckt mehr: Ein Container besteht nicht nur aus den Dateien, die im Image stecken. Er bietet auch Platz für Nutz- und Konfigurationsdaten. Die liegen üblicherweise auf separat vom Docker-Daemon verwalteten Volumes, die unabhängig vom Container existieren. So kann man mit einem neuen Image Software aktualisieren, ohne dadurch die Nutz- oder Konfigurationsdaten zu verlieren. Um eventuellen Havarien vorzubeugen: Volumes sind nur so lange vor Aufräumprozessen gefeit, wie mindestens ein Container sie referenziert.
Praxis-Graben
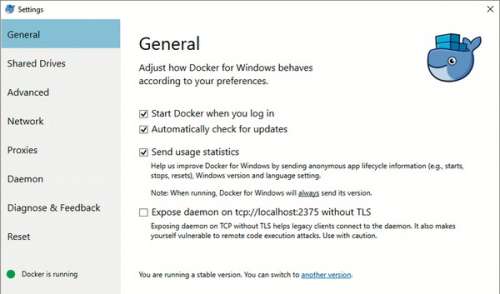
Docker ist eigentlich zu mehr berufen als für den Einsatz als Sparvirtualisierung auf einem Host. Es wird gern als Baustein für die Industrialisierung der IT beschrieben: Es soll dafür sorgen, dass sich Anwendungen gut skalieren lassen, indem man bei wachsendem Bedarf einfach weitere Server-Knoten mit Containern beschickt. Dank automatisierter Prozesse für das kontinuierliche Zusammenführen und den Test neuer Features sollen Entwickler und Admins besser kooperieren. Hilfreich dabei sind Verwaltungswerkzeuge wie Kubernetes – für den Einsatz im Kleinen sind die allerdings Overkill.
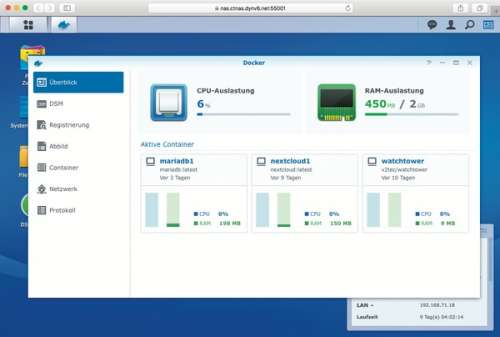
Was auf den ersten Blick super klingt, nämlich die Möglichkeit, Docker auf verschiedenen Plattformen wie Linux, NAS und Windows zu nutzen, hat in der Praxis viele Tücken. Docker Inc. und Microsoft haben viel Mühe investiert, um sowohl Container mit Windows- als auch Linux-Inhalten ausführen zu können (bei letzteren läuft eine virtuelle Maschine mit Linux im Hintergrund). Doch der Erfolg bei Windows-Containern ist mäßig und der eigentlich beabsichtigte Mischbetrieb scheitert daran, dass sich die Welten im Detail fremd sind [3].
Schwierig wird es besonders dann, wenn es auf die Details der Netzwerkkonfiguration ankommt – das gilt für Windows wie NAS gleichermaßen und für IPv6 sogar für Linux. Docker auf einem Linux-Host kennt verschiedene Spielarten für die Netzwerkanbindung der Container, für die es unter Windows nicht immer eine Entsprechung gibt. Auch die NAS-Hersteller kochen da ihr eigenes Süppchen. Wenn ein Container allzu sehr auf Details im Netz oder des Dateisystems pocht (etwa das Vorhandensein von ACLs), läuft er womöglich nur unter Linux und nicht mal auf einem NAS.
Images im Heuhaufen
Zum Kasten: Warum immer nur Docker?
Wenn man für eine Aufgabenstellung ein fertiges Container-Image sucht, wird man oft erschlagen. Im Docker-Hub oder im Docker-Store (dem Nachfolger des Hub) finden sich schon für ein und dieselbe Software durchaus mehrere hundert Images. Für deren Güte gibt es grobe Anhaltspunkte, etwa die Anzahl der Downloads. Obendrein sponsort die Firma Docker Inc. ein Team, das „offizielle“ Images besonders beliebter Software erstellt. Letzteres garantiert gewisse Qualitätsstandards – Docker Inc. spricht von „vorbildlichen Images“.
Im Umkehrschluss heißt das jedoch, dass ein Großteil der Images auf dem Docker Hub frei von jeglicher Kontrolle dorthin gelangt: Das nutzte seit Juli 2017 ein Nutzer namens „docker123321“ aus und stellte via Docker Hub Varianten gängiger Images wie mysql bereit (üblicherweise dann als docker123321/mysql), die zur Installation eines Krypto-Miners dienten. Fast ein Jahr lieferte der Docker Hub solche Images aus.
Argwohn ist letztlich des Docker-Fans höchste Tugend: Spätestens für den produktiven Einsatz sollte man Images sehr sorgfältig auf den Zahn fühlen. Über grundlegende Fragestellungen hinaus gibt es viele Details, die ein „vorbildliches“ Image beachten sollte. Manches ist auf den professionellen Einsatz gemünzt, etwa die zur Konfiguration unterstützten Techniken. Unsere Tipps zum Beurteilen von Images erhalten Sie ab Seite 114. Der unmittelbar folgende Artikel versorgt Sie mit einer Liste unserer Erfahrung nach besonders nützlichen Images. (ps@ct.de)
